Archivierung japanischer Games - 3
Videospiele in der Campusbibliothek an der Universität Leizpig
Am 27. April 2018 gab es ein Treffen des Arbeitskreises Japan-Bibliotheken in Leipzig. An diesem Vormittag haben Herr Jun.-Prof. Martin Roth (Juniorprofessor der Japanologie an der Uni. Leipzig) und Herr André Lahmann (UB Leipzig) freundlicherweise ihr Game-Archivierungsprojekt an der Universität Leipzig und UB Leipzig vorgestellt. Die Teilnehmer des Treffens durften dabei auch den Raum "[j]Games Lab." und den speziellen Seminarraum begehen und ansehen. Dies ist ein Bericht vom [j]Games Lab. und dem Seminarraum in der Campusbibliothek der Universität Leipzig.
Anlass zu diesem Projekt gab die Schenkung der japanischen Computer Entertainment Rating Organization (CERO) an die Universität Leipzig. Sie erhielt ca. 4500 Titel Videospiele (1). Mit Hilfe der UB Leipzig sind diese Spiele nicht bloß in irgendeiner dunklen Ecke der Bibliothek untergebracht, sondern sie sind für wissenschaftliche Zwecke zugänglich.
Die "Wissenschaft" enthält hier zwei Aspekte, Lehre und Forschung. Für die Forschung wurde ein Raum "[j]Games Lab." innerhalb der Campusbibliothek der Uni. Leipzig eingerichtet, in dem man die Videospiele (meist sog. console game) tatsächlich "spielen" kann. Dafür stehen im [j]Games Lab. unterschiedliche Abspielgeräte und Steuergeräte bereit.

Bewahrt werden hier nicht nur die Softwares (CD- oder DVD-ROMs), sondern auch Spielkonsolen und Steuergeräte. Es gibt dort zum Teil auch japanische Konsolen, weil einige Spiele nur mit japanischem Konsolen gespielt werden können.
Der Zugang zum [j]Games Lab. wird kontrolliert. Benutzer, welche sich im Voraus über eine Liste bei der Campusbibliothek angemeldet haben, erhalten den Schlüssel, mit dem sich die Türe dieses Raumes aufsperren lässt.

Hier können Spielszenen auch als Bild und Videoimage aufgezeichnet werden. Weil es dabei jedoch juristisch-urheberrechtliche Probleme gibt, dürfen solche Aufnahmen nicht veröffentlicht werden. Wie im vorherigen Blogbeitrag beschrieben, ist die Aufzeichnung für die Forschung eigentlich sehr interessant.

Die Spiele sind sowohl in einer Excel-Liste verzeichnet als auch im Regal nach Signatur aufgestellt. Sie sind bewusst physisch systematisch aufgestellt, damit die Benutzer so zufällig auch auf ein neues Spiel stoßen können(2). Der Aufbau der Signatur ist: "Art der Konsole", "Vercutterter Titel", "Veröffentlichungsjahr", "Versionsunterschiede durch Alphabet" - Hier das Beispiel auf dem Foto: "DS F49a 2007 A"
Wer noch weitere Fotos ansehen will, wirft einen Blick in die Fotogallerie auf der Homepage von [j]Games.
Während das [j]Games Lab. die Nutzung der Videospiele zum Forschungszwecke anbietet, ist daneben ein weiterer Seminarraum innerhalb der Campusbibliothek der Universität Leipzig eingerichtet. Dieser Raum dient der Lehre, und ein Dozierender kann diesen Raum für einen Unterricht benutzen, in dem die Videospiele dort angezeigt und gespielt werden. Dafür ist der Raum mit 11 High spec Rechner und einem speziellen Beamer ausgerüstet, der mit unterschiedlichen Spielkonsolen verbunden werden und verschiedene Spielszenen projizieren kann.
In dieser Umgebung ist ein Forschungsprojekt Diggr angesiedelt (3). Das von der DFG geförderte Projekt zielt darauf, eine datenbasierte, von Linked Open Data (LOD) unterstützte Infrastruktur für Game-Forschung zu etablieren.
Wie im letzten Beitrag erwähnt, wirft die Archivierung von Videospielen Themen auf, die für die nächste Entwicklung der Bibliothek im Allgemeinen interessant sind. In diesem Sinne ist die Aktivität der UB Leipzig bemerkens- und nennenswert.
1) http://home.uni-leipzig.de/jgames/de/jgames-lab/ (Stand: 17.07.2018)
2) Sebastian Kötz beschreibt die Überlegung über Browsing bei der Einrichtung des [j]Games Lab. näher (Seite 43-45).
Kötz, Sebastian. Videospiele als Herausforderung des Bestands- und Nutzungsmanagements in der Universitätsbibliotheks Leipzig. Berlin : Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin, 2017. (Berliner Handreichungen zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 423). https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/18981/MA_Koetz_BH_423_ns.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Stand: 17.07.2018)
Am 27. April 2018 gab es ein Treffen des Arbeitskreises Japan-Bibliotheken in Leipzig. An diesem Vormittag haben Herr Jun.-Prof. Martin Roth (Juniorprofessor der Japanologie an der Uni. Leipzig) und Herr André Lahmann (UB Leipzig) freundlicherweise ihr Game-Archivierungsprojekt an der Universität Leipzig und UB Leipzig vorgestellt. Die Teilnehmer des Treffens durften dabei auch den Raum "[j]Games Lab." und den speziellen Seminarraum begehen und ansehen. Dies ist ein Bericht vom [j]Games Lab. und dem Seminarraum in der Campusbibliothek der Universität Leipzig.
Anlass zu diesem Projekt gab die Schenkung der japanischen Computer Entertainment Rating Organization (CERO) an die Universität Leipzig. Sie erhielt ca. 4500 Titel Videospiele (1). Mit Hilfe der UB Leipzig sind diese Spiele nicht bloß in irgendeiner dunklen Ecke der Bibliothek untergebracht, sondern sie sind für wissenschaftliche Zwecke zugänglich.
Die "Wissenschaft" enthält hier zwei Aspekte, Lehre und Forschung. Für die Forschung wurde ein Raum "[j]Games Lab." innerhalb der Campusbibliothek der Uni. Leipzig eingerichtet, in dem man die Videospiele (meist sog. console game) tatsächlich "spielen" kann. Dafür stehen im [j]Games Lab. unterschiedliche Abspielgeräte und Steuergeräte bereit.

Bewahrt werden hier nicht nur die Softwares (CD- oder DVD-ROMs), sondern auch Spielkonsolen und Steuergeräte. Es gibt dort zum Teil auch japanische Konsolen, weil einige Spiele nur mit japanischem Konsolen gespielt werden können.
Der Zugang zum [j]Games Lab. wird kontrolliert. Benutzer, welche sich im Voraus über eine Liste bei der Campusbibliothek angemeldet haben, erhalten den Schlüssel, mit dem sich die Türe dieses Raumes aufsperren lässt.

Hier können Spielszenen auch als Bild und Videoimage aufgezeichnet werden. Weil es dabei jedoch juristisch-urheberrechtliche Probleme gibt, dürfen solche Aufnahmen nicht veröffentlicht werden. Wie im vorherigen Blogbeitrag beschrieben, ist die Aufzeichnung für die Forschung eigentlich sehr interessant.

Die Spiele sind sowohl in einer Excel-Liste verzeichnet als auch im Regal nach Signatur aufgestellt. Sie sind bewusst physisch systematisch aufgestellt, damit die Benutzer so zufällig auch auf ein neues Spiel stoßen können(2). Der Aufbau der Signatur ist: "Art der Konsole", "Vercutterter Titel", "Veröffentlichungsjahr", "Versionsunterschiede durch Alphabet" - Hier das Beispiel auf dem Foto: "DS F49a 2007 A"
Wer noch weitere Fotos ansehen will, wirft einen Blick in die Fotogallerie auf der Homepage von [j]Games.
Während das [j]Games Lab. die Nutzung der Videospiele zum Forschungszwecke anbietet, ist daneben ein weiterer Seminarraum innerhalb der Campusbibliothek der Universität Leipzig eingerichtet. Dieser Raum dient der Lehre, und ein Dozierender kann diesen Raum für einen Unterricht benutzen, in dem die Videospiele dort angezeigt und gespielt werden. Dafür ist der Raum mit 11 High spec Rechner und einem speziellen Beamer ausgerüstet, der mit unterschiedlichen Spielkonsolen verbunden werden und verschiedene Spielszenen projizieren kann.
In dieser Umgebung ist ein Forschungsprojekt Diggr angesiedelt (3). Das von der DFG geförderte Projekt zielt darauf, eine datenbasierte, von Linked Open Data (LOD) unterstützte Infrastruktur für Game-Forschung zu etablieren.
Wie im letzten Beitrag erwähnt, wirft die Archivierung von Videospielen Themen auf, die für die nächste Entwicklung der Bibliothek im Allgemeinen interessant sind. In diesem Sinne ist die Aktivität der UB Leipzig bemerkens- und nennenswert.
1) http://home.uni-leipzig.de/jgames/de/jgames-lab/ (Stand: 17.07.2018)
2) Sebastian Kötz beschreibt die Überlegung über Browsing bei der Einrichtung des [j]Games Lab. näher (Seite 43-45).
Kötz, Sebastian. Videospiele als Herausforderung des Bestands- und Nutzungsmanagements in der Universitätsbibliotheks Leipzig. Berlin : Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin, 2017. (Berliner Handreichungen zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 423). https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/18981/MA_Koetz_BH_423_ns.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Stand: 17.07.2018)
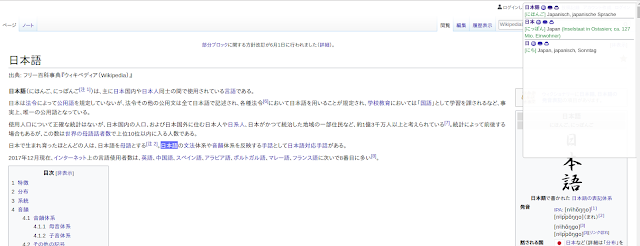

Kommentare
Kommentar veröffentlichen